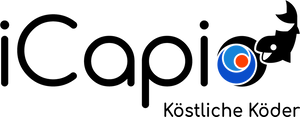Einleitung
Wenn wir an Fische denken, kommt uns zuerst das Bild von blitzschnellen Raubzügen und scharfen Augen in den Sinn. Doch das ist nur ein Teil ihrer Wahrnehmungswelt.
Fische leben in einer Sinfonie aus Reizen, die wir Menschen kaum erfassen können. Sie sehen, spüren, hören und riechen ihr Umfeld auf faszinierende Weise.
Ein Raubfisch „fühlt“ die Bewegung einer Beute über die Seitenlinie, hört Schwingungen über das Innenohr, teils schmeckt er bereits über die Haut, und riecht chemische Signale, die im Wasser gelöst sind. Diese Kombination macht ihn zu einem perfekt abgestimmten Unterwasserjäger.
Der Geruchssinn spielt dabei oft die entscheidende Rolle – gerade dann, wenn Sicht und Bewegung keine klaren Hinweise geben. Schon geringe Spuren von Aminosäuren oder Beutefisch im Wasser genügen, damit ein Räuber aufhorcht oder eine Forelle in Richtung Köder dreht.
Wissenschaftlich betrachtet ist die Nase eines Fisches ein kleines Wunderwerk. In ihr liegen fein gefaltete Lamellen voller Sinneszellen, die Geruchsstoffe aus dem Wasser filtern und über Nervenbahnen direkt ins Gehirn leiten – in Sekundenbruchteilen entsteht ein „chemisches Bild“ der Umgebung [Ghosh & Chakrabarti, 2013]
Es gibt viele Fischsinne, die auch im Internet oder verschiedenen Veröffentlichungen gut beschrieben sind.

🧠 Wie das Fischauge funktioniert
Das Auge eines Fisches arbeitet nach dem gleichen Grundprinzip wie das des Menschen – Licht trifft auf eine Linse und wird auf die Netzhaut fokussiert.
Doch weil Wasser ein ganz anderes optisches Medium ist als Luft, hat sich das Fischauge clever angepasst:
Fische besitzen eine fast kugelförmige Linse, die deutlich stärker bricht als unsere. Sie sorgt dafür, dass Lichtstrahlen auch unter Wasser – wo der Brechungsunterschied zwischen Hornhaut und Wasser gering ist – sauber gebündelt werden.
Fische sind im Gegensatz zu uns Menschen von Natur aus nahakkommodiert.
Ihre kugelförmige Linse hat eine sehr hohe Brechkraft, wodurch nahe Objekte automatisch scharf abgebildet werden.
Das ist im dichten, lichtstreuenden Medium Wasser sinnvoll – dort sind Beute, Hindernisse oder Artgenossen meist in kurzer Distanz.
Wenn ein Fisch weiter entfernte Objekte sehen will, muss er aktiv akkommodieren:
Ein spezieller Muskel, der Musculus retractor lentis, zieht die Linse nach hinten in Richtung Netzhaut, um den Brennpunkt nach hinten zu verlagern – so werden weiter entfernte Objekte scharfgestellt.
Lässt der Muskel los, gleitet die Linse wieder nach vorn, und der Fisch sieht automatisch im Nahbereich scharf.
Man könnte also sagen:
👉 Der Ruhezustand des Fischauges ist die Nahsicht, nicht die Fernsicht wie beim Menschen.
Fische sind evolutionär auf den Nahbereich optimiert (kurzsichtig).
Ihre kugelförmige Linse mit sehr hoher Brechkraft bildet nahe Objekte scharf ab, während entfernte Gegenstände oft unscharf erscheinen.
Man könnte also sagen:
Fische sind physiologisch kurzsichtig, aber genau so gebaut, wie es ihre Umwelt verlangt.
Unter Wasser sind Sichtweiten oft begrenzt (Trübung, Streuung, Partikel, Lichtabsorption).
Daher bringt es keinen Vorteil, in 20 oder 50 Metern scharf zu sehen – entscheidend ist, was im Umkreis von wenigen Metern passiert.
Und genau dort findet die Jagd statt.
Das Seitenlinienorgan
Das Seitenlinienorgan bei Fischen (auch „Lateral‑Line‑System“) ist ein spezialisiertes mechanosensorisches Sinnesorgan, mit dem Fische Wasserbewegungen, Druckänderungen und Strömungen in ihrer unmittelbaren Umgebung wahrnehmen können.
Das System besteht aus vielen kleinen Sinnesorganen, den sogenannten Neuromasten, die entweder oberflächlich auf der Haut liegen („superficial neuromasts“) oder in Kanälen unter der Haut eingebettet sind („canal neuromasts“).
Unter diesem Link findet Ihr einige sehr coole Bilder zu den Neuromasten: https://www.sciencephoto.com/media/801644/view
Jeder Neuromast enthält Haarzellen (sensory hair cells), die mit einer gallertartigen Kuppel (Cupula) bedeckt sind. Wird diese Cupula durch eine Wasserbewegung oder Druckänderung abgelenkt, so werden die Haarzellen mechanisch gereizt – das führt zur Öffnung von Ionenkanälen, Depolarisation der Zelle und Weiterleitung eines Signals an das Gehirn.
Superficial Neuromasten reagieren v. a. auf Wassergeschwindigkeit bzw. lokale Strömung („velocity detectors“), während Canal‑Neuromasten eher Druckgradienten oder Beschleunigungen wahrnehmen („pressure / acceleration detectors“).
Mit Hilfe dieses Sinnes können Fische u. a. folgende Aufgaben erfüllen: Strömungen wahrnehmen und sich orientieren (z. B. gegen die Strömung schwimmen = Rheotaxis), Beutetiere oder Raubfische entdecken, Hindernisse vermeiden, in Schulen synchron schwimmen oder in dunklem bzw. trübem Wasser navigieren.
In diesem Blogartikel schauen wir uns die Fischnase etwas genauer an.
Fische sind faszinierende Sinnesjäger: Sie nehmen ihre Umwelt nicht nur über Augen und Seitenlinien wahr, sondern vor allem über chemische Reize im Wasser. Der Geruchssinn („Olfaktion“) spielt eine entscheidende Rolle bei der Nahrungssuche, Fortpflanzung, Orientierung und beim Erkennen von Artgenossen.
Studien zeigen, dass der Fischgeruchssinn deutlich komplexer aufgebaut ist, als lange angenommen – er arbeitet über hochspezialisierte Riechzellen, die selbst geringste Mengen wasserlöslicher Stoffe wahrnehmen können (Hara 1992; Ghosh & Chakrabarti 2013).

Der Geruchssinn der Raubfische – warum echte Fischduftstoffe Fänge bringen
Fische sind faszinierende Sinnesjäger: Sie nehmen ihre Umwelt nicht nur über Augen und Seitenlinien wahr, sondern vor allem über chemische Reize im Wasser. Der Geruchssinn („Olfaktion“) spielt eine entscheidende Rolle bei der Nahrungssuche, Fortpflanzung, Orientierung und beim Erkennen von Artgenossen.
Studien zeigen, dass der Fischgeruchssinn deutlich komplexer aufgebaut ist, als lange angenommen – er arbeitet über hochspezialisierte Riechzellen, die selbst geringste Mengen wasserlöslicher Stoffe wahrnehmen können (Hara 1992; Ghosh & Chakrabarti 2013).
Fische habe doppelt so viele Nasenlöcher wie wir Menschen, aber nutzen diese nicht zum Atmen. Interessant ist, dass die Riechzellen mit großen Nervenbahnen direkt mit dem Fisch-Gehirn verbunden sind. Bei einigen Fischen verläuft hier sogar einer der Hauptnerven. 4 Nasenlöcher, dicke Nervenbahnen: sowas geschieht in der Natur nicht spontan, sondern hat sich in der Evolution durchgesetzt. Dies unterstreicht die Wichtigkeit des „Riechens“ bei Fischen.
Die Riechorgane befinden sich in zwei Taschen an beiden Seiten der Fischschnauze. Diese Taschen sind mit Nerven ausgekleidet, die hochempfindlich auf im Wasser gelöste Substanzen reagieren. Fische besitzen zwei Nasenöffnungen auf jeder Seite der Schnauze. Das Wasser strömt durch die erste Nasenöffnung ein, passiert die sensorischen Nerven und verlässt die Schnauze dann durch die hintere. So kann der Fisch beim Schwimmen jeden im Wasser gelösten Duftstoff wahrnehmen.
Bilder aus einer morphologischen Studie [Ghosh, S.K. & Chakrabarti, P. (2013)] belegen, wie die Riechzellen der Nasen über dicke Nervenbahnen direkt mit dem Gehirn verknüpft sind.

Forellen wie die Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) gehören zu den sensibelsten „Riechern“ im Süßwasser.
Studien zeigen, dass sie bestimmte Aminosäuren, Fettsäuren und Vitamine im Nanomolarbereich erkennen können – also in extrem geringen Konzentrationen (Valdés et al., 2015).
Der Grund liegt in ihrem hochgefalteten Riechorgan, der sogenannten olfaktorischen Rosette:
Diese besteht aus zahlreichen Lamellen, die mit spezialisierten Sinneszellen besetzt sind. Sobald wasserlösliche Stoffe an diese Zellen gelangen, lösen sie ein neuronales Signal aus – der Fisch erkennt „Futter“.
➡️ Praxis: Wenn Forellen den Köder nicht sehen (trübes Wasser, Dämmerung, Winter), übernimmt der Duft die Führungsrolle.
Köder, die echte Fischbestandteile abgeben, wirken dadurch natürlicher und werden öfter attackiert.
Hecht, Zander & Barsch – Raubfische mit Kombisinn
Hecht, Zander und Barsch sind klassische Sichtjäger, aber unterschätze nie ihre Nase. Auch sie haben 4 Nasenlöcher, jedoch mit etwas reduzierter Anzahl von Riechzellen. Bei Hechten ist der Geruchssinn sicher nicht der primäre Sinn für die Beuteerkennung. Aber chemische (geruchs-)Reize können sein Verhalten beeinflussen. Und gerade im Winter fangen viele Angler mit stark riechenden Beutefischen wie Makrele oder Hering sehr gut. Deadbait Angeln funktioniert so auch im Trüben Wasser, obwohl das Seitenlinienorgan und die Augen kaum zum Zug kommen.
Barsche reagieren nachweislich auf chemische Signale aus der Umwelt. Labor- und Feldstudien belegen, dass Barsche chemische Reize von Beutefischen wahrnehmen und ihr Verhalten entsprechend anpassen [Henderson, L. J., Ryan, M. R. & Rowland, H. M. (2017)]. Insbesondere bei jungen Barschen können sowohl visuelle als auch chemische Signale das Beutefangverhalten beeinflussen. Chemische Reize wirken als Orientierungshilfe und können das Such- und Fressverhalten verstärken, sind aber in der Regel ergänzend zu den visuellen Sinnen.
➡️ Fazit aus Labor und Praxis:
Geruch kann beeinflussen, ob und wie Fische beißen. Duftstoff-Köder werden nicht nur schneller entdeckt, sondern auch länger im Maul behalten – dies kann ein entscheidender Vorteil für den Anhieb sein.
Wichtig ist aber: um in die Fischnase zu gelangen, und dann am Rezeptor zu binden müssen die Geruchsstoffe im Wasser molekulardispers gelöst sein. Aufgepasst also bei Ölen als Attractants, denn reine Öle lösen sich in Wasser nicht. Das kennst Du vielleicht, wenn Du am Forellensee bist und an der Oberfläche schwimmen kleine "Ölteppiche". Das ist weder gut für die Natur, Vögel, Fische, noch hilft es dem Angler.
Die iCapio Aktivköder, wie Hering, Garnele oder Knoblauch aber auch unsere Gele nutzen als Hauptbestandteil wasserlösliche oder teillösliche Bestandteile, keine Öle. Hier ist garantiert, dass die Gerüche es auch bis in die Fischnase schaffen.
Literaturstellen
Ghosh, S.K. & Chakrabarti, P. (2013): Studies on the morphology of the olfactory organ in the freshwater teleost, Labeo bata (Hamilton). Mesopot. J. Mar. Sci., 28(2): 163–174.
Hara, T.J. (1992): Mechanism of olfaction. In: Fish Chemoreception. Chapman & Hall.
Hara, T.J. (1994): Diversity of chemical stimulation in fish olfaction. Rev. Fish Biol. Fish., 4: 1–35.
Henderson, L. J., Ryan, M. R. & Rowland, H. M. (2017). Perch, Perca fluviatilis show a directional preference for, but do not increase attacks toward, prey in response to water‑borne cortisol. PeerJ, 5:e3883. DOI:10.7717/peerj.3883.
Link: https://eprints.gla.ac.uk/148100/?utm_source=chatgpt.com
Valdés, J. et al. (2015): Analysis of olfactory sensitivity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. Fish Biol.
Døving, K.B. et al. (1980): Olfactory sensitivity to bile acids in salmonid fishes. Acta Physiol. Scand. 108: 121–131.